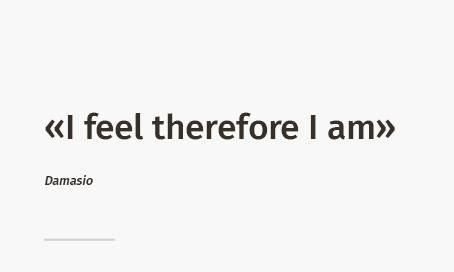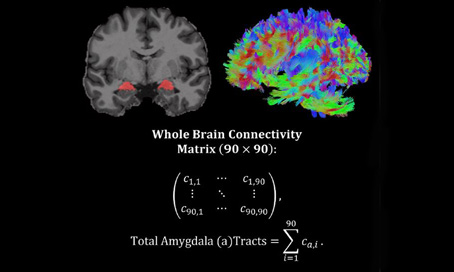Dr. med. Naomi Lange, stellvertretende Oberärztin der Klinik Südhang und Assistenzärztin Forschung Hepatologie am Inselspital Bern, forscht zu Genderaspekten in der Hepatologie. Im Interview mit Tanya Karrer für GastroMag erklärt sie die Relevanz des Themas und weist darauf hin, dass nicht nur das biologische Geschlecht, sondern auch die soziale Wahrnehmung einen Einfluss auf eine Lebererkrankung haben.
Tanja Karrer, Gesundheitsredaktorin, im Gespräch mit Dr. med. Naomi Lange
GastroMag: Dr. Lange, Sie forschen in der Hepatologie und arbeiten klinisch in der Klinik Südhang im Bereich Suchtmedizin. Wie passen die beiden Fachgebiete zusammen?
Es gibt zahlreiche Verbindungen. Ein wichtiges Thema ist der Alkoholkonsum. Dieser steht in enger Verbindung mit Lebererkrankungen. Zudem lassen sich Gesprächsführungstechniken, wie Motivational Interviewing, in beiden Bereichen anwenden. Es geh darum, Patient*innen dazu zu motivieren, ihren Lebensstil anzupassen und ihr Verhalten zu ändern. Gerade bei der metabolischen Fettlebererkrankung ist die Verhaltensänderung noch immer der wichtigste Pfeiler der Behandlung.
Sie befassen sich mit Gender-Aspekten in der Medizin und in der Hepatologie. Gender ist für viele ein Reizwort.
Es geht nicht darum, Medizin speziell für Frauen zu machen. Gendermedizin ist für alle wichtig. Wenn wir mehr geschlechterspezifische Daten haben, können wir bessere Diagnosen stellen und optimiert Therapien entwickeln – für alle Geschlechter.
Welche Aspekte sind bei Lebererkrankungen typisch geschlechtsspezifisch?
Ich nenne zwei Beispiele: Die Autoimmunhepatitis tritt bei Frauen ungefähr viermal häufiger auf als bei Männern. Bei der primär biliären Cholangitis liegt das Verhältnis betroffener Frauen zu Männern sogar bei etwa 9:1.